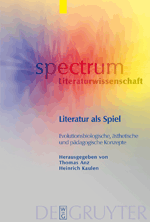Literatur als Spiel
Evolutionsbiologische, ästhetische und pädagogische Aspekte.
Herausgegeben von Thomas Anz und Heinrich Kaulen
Verlag de Gruyter, Berlin und München 2009
„Tiere spielen genau so wie Menschen“, konstatierte Johan Huizinga in seinem berühmten Buch „Homo Ludens“ und erklärte das Spiel zur anthropologischen Basis der Kultur. Gleichzeitig konzipierte Wittgenstein den Begriff des „Sprachspiels“. Solche Wissenschaftstraditionen weiterentwickelnd, gehen 43 Aufsätze sprachlichen, literarischen, ästhetischen und pädagogischen Aspekten des Spiels nach – mit Beispielen von der Antike bis zu Computerspielen der Gegenwart. Der Band vermittelt wichtige Grundlagen und vielfältige Anregungen zu einer Kulturtheorie des Spiels.
Inhalt
Thomas Anz / Heinrich Kaulen
Einleitung. Vom Nutzen und Nachteil des Spiel-Begriffs für die Wissenschaften 1
Spielkonzepte in der Ästhetik und Literaturtheorie
Karl Eibl
Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Ein evolutionsbiologischer Zugang 11
Gerhard Lauer
Das Spiel der Einbildungskraft. Zur kognitiven Modellierung von Nachahmung, Spiel und Fiktion 27
Tilmann Köppe
Fiktion, Praxis, Spiel. Was leistet der Spielbegriff bei der Klärung des Fiktionalitätsbegriffs? 39
Katja Mellmann
Das ‚Spielgesicht‘ als poetisches Verfahren. Elemente einer verhaltensbasierten Fiktionalitätstheorie 57
Ulrike Zeuch
Gibt es ein Drittes neben Faktizität und Fiktionalität? Zum Wahrheitsanspruch der Literatur am Beispiel von Kafkas Erzählung Eine kleine Frau 79
Christian Kohlross
Was ist die Kunst, was ist der Mensch? Zwei Fragen und der Versuch, sie mit dem Begriff des Spiels zu beantworten. Oder: Variationen zu einem Diktum Schillers 89
Jürgen Brokoff
Die Verselbständigung der Poesie als Spiel am Ende des 18. Jahrhunderts und der Spielbegriff
bei Johan Huizinga und Jost Trier 101
Peter Brandes
Das Spiel der Bedeutungen im Prozess der Lektüre. Überlegungen zur Möglichkeit einer Literaturtheorie des Spielsm 115
Mario Bührmann
Das ‚Spiel der Naturvölker‘ im Spiegel der deutschen Ethnologie. Zur Ästhetik von Mythos, Kult und Spiel bei Adolf Ellegard Jensen 135
Literarische Spielformen vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert
Regina Toepfer
Die Passion Christi als tragisches Spiel. Plädoyer für einen poetologischen Tragikbegriff in der Mediävistik 159
Friedrich Michael Dimpel
Das Rollenspiel als Modell für eine Formalisierung der Figurenstruktur im höfischen Roman 177
Klaus Ridder / Rebekka Nöcker / Martina Schuler
Spiel und Schrift. Nürnberger Fastnachtspiele zwischen Aufführung und Überlieferung 195
Johannes Klaus Kipf
Auctor ludens. Der Topos des spielerischen Schreibens in poetologischen Paratexten unterhaltender Literatur im Renaissance-Humanismus und in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit 209
Peter-André Alt
Sexus ludens. Androgynie als Spiel der Rhetorik und des Theaters
in den Dramen Daniel Caspers von Lohenstein 231
Alexander Honold
Fest und Spiel in der Klassischen Walpurgisnacht 255
Roman Luckscheiter
Beherrschter Enthusiasmus. Pädagogik und Ästhetik des Rollentauschs in Achim von Arnims Erzählung Fürst Ganzgott und Sänger Halbgott 267
Literarische Spielformen zwischen Moderne und Postmoderne
Barbara Thums
Asketisches Künstlertum und klösterliche Einsamkeit. Inszenierungen der Einbildungskraft um 1900 279
Nicola Gess
„Magisches Denken“ im Kinderspiel. Literatur und Entwicklungspsychologie im frühen 20. Jahrhundert 295
Oliver Ruf
„Ein Spiel mit den schäbigen Überbleibseln“. Ludische Literatur – Theorie und Thesen (von Friedrich Schiller zur Avantgarde) 315
Barbara Wildenhahn
Maskenball. Spiel und Fiktion bei Alfred Döblin 329
Jörg Löffler
Zwischen Nachahmung und Kreativität. Spielformen fingierter Autorschaft am Beispiel von
Jorge Luis Borges’ Erzählung Pierre Menard, Autor des Quijote 353
Renata Plaice
Das Spiel als das Dynamische. Der Begriff des Spiels zwischen Moderne und Postmoderne 359
Stefan Neuhaus
Das Subversive des Spiels. Überlegungen zur Literatur der Postmoderne 371
Birte Giesler
Formen und Funktionen von Spiel und Ritual in Igor Bauersimas futur de luxe 391
Spielformen und Textsorten: Regeln, Normen, Rituale
Anke Bosse
Retheatralisierung in Theater und Drama der Moderne.
Zum Spiel im Spiel 417
Stephan Kraft
Optimistische ‚Endspiele‘ – vom Nutzen des Zufalls in Spiel und Komödie 431
Christian Klein
Vom Spiel des Lebens. Regelverstöße und Sanktionsmöglichkeiten im autobiografischen Diskurs 439
Eva Annabelle Blume
Spiel- und Erkenntnismittel im Aphorismus der Wiener Moderne 455
Joachim Jacob
Ernst oder Spiel? Zur ethischen Dimension ästhetischer Spiele am Beispiel der Konkreten Poesie 465
Rüdiger Singer
Lyrik-Parodien: Spielverderberei oder lyrisches Mit-Spiel? Beobachtungen anhand des Spiels mit der ‚Regel‘ Wiederholung 477
Andreas Schumann
Sprachspiel und Individualität. Neue Tendenzen einer Literatur der Migration 499
Elisabeth Balß
Zur Bedeutung von Ritualen und ritualisierten Abläufenm in erfolgreicher Literatur 509
Literatur und andere Spiele
Pierre Mattern
Text, Wettkampf, Spiel. Zur historischen Typologie des Verhältnisses Sport – Literatur 527
Frank Degler
A Willing Suspension of Misbelief. Fiktionsverträge in Computerspiel und Literatur 543
Sabrina Schrammel / Konstantin Mitgutsch
Die ludische Kultur des Computerspielens. Eine spieltheoretischkulturanthropologische
Analyse am (Bei-)Spiel Zoo Tycoon 2 561
Spielkonzepte im Literatur- und Sprachunterricht
Heinrich Kaulen
Spielmethoden ohne Spieltheorie? Zur Geschichte und
aktuellen Konjunktur des Spielbegriffs in der Literaturdidaktik 579
Gundel Mattenklott
Spiele in ästhetischen Bildungsprozessen 601
Sabine Jentges
Vom Spielen und Lernen 617
Marcus Steinbrenner
Mimetische Annäherung an lyrische Texte im Sprach-Spiel des literarischen Gesprächs 645
Bianca Schwindt
Spielerei oder ernstzunehmende Texterschließung? Möglichkeiten und Probleme des ,Gestaltenden Interpretierens‘ 669
Tillmann F. Kreuzer
Mein Text bin ich. Szenische Darstellung und kreatives Schreiben 683
Marie-Luise Wünsche
Magische Buchwelten und phantastische Sprachspiele. Zur Ästhetik und Didaktik gegenwärtiger Kinder- und Jugendliteratur 697
Juliane Stude
Spontane Sprachspiele unter Vorschulkindern als Erwerbskontext für metasprachliche Fähigkeiten 715
Weitere Informationen zu dem Buch folgen in Kürze.
-----------------------